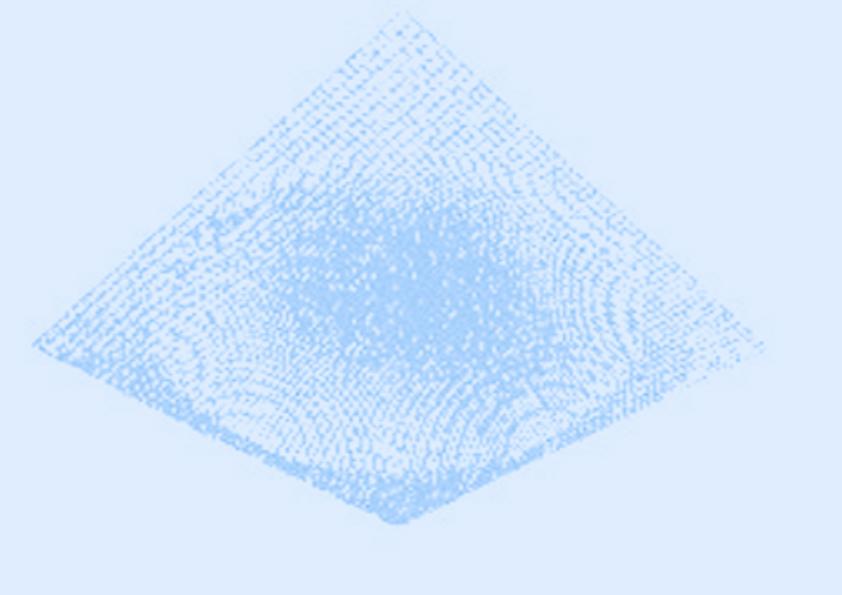 Vertrauen näher betrachten
Vertrauen näher betrachtenin Memoriam Balthasar Staehelin, Prof. Dr. med
Vertrauen ist der positive Aspekt menschlicher Bindung und menschlicher Hoffnung
 Vertrauen ist nicht Mistrauen, nicht
Zweifel, nicht Verdacht, nicht Unsicherheit, nicht Zögern, nicht Angst, nicht Verwirrung, nicht
Ablehnung, nicht Gegenwehr, nicht Abwendung, nicht Abwarten, nicht Desinteresse,
nicht Indifferenz, nicht Willensschwäche, nicht Rückzug, nicht Isolation, nicht
Flucht, nicht Ueberheblichkeit
Vertrauen ist nicht Mistrauen, nicht
Zweifel, nicht Verdacht, nicht Unsicherheit, nicht Zögern, nicht Angst, nicht Verwirrung, nicht
Ablehnung, nicht Gegenwehr, nicht Abwendung, nicht Abwarten, nicht Desinteresse,
nicht Indifferenz, nicht Willensschwäche, nicht Rückzug, nicht Isolation, nicht
Flucht, nicht Ueberheblichkeit
Vertrauen ist nicht Abhängigkeit, nicht Zwang, nicht Sucht, nicht Unfreiheit, nicht Selbstaufgabe, nicht Destruktion
Vertrauen ist auf Dauer angelegt. Vertrauen ist nicht endlich, nicht Abbruch, nicht Trennung, nicht Lieblosigkeit, nicht Egoismus. Im Vertrauen soll es dem Du gut gehen können
Vertrauen hat jeder Mensch und er selbst kann es deshalb verschütten, überdecken - und auch dann ist es noch da, eben verschüttet, verliert bewusste Wirkung.
Das Urvertrauen jedes Menschen ist
also von Anfang an da, gehört zum Wesen des Menschen. Es muss nicht entstehen durch eigene Anstrengung,
entsteht nicht durch sozialen Kontakt. Weil es von Anfang an
zum Menschen gehört, es ist da.
Wir scheinen oft am anderen Menschen zu scheitern - oder letztlich doch an uns
selbst, an unserer Verantwortungsfähigkeit und Vertrauensfähigkeit bei diffuser
Angst ?
Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007, auch andere Statistiken
enthalten kaum spezifische Information zum Psychosomatischen Allgemeinsyndrom
(Prof. Dr. med. B. Staehelin). Auch hier nicht:
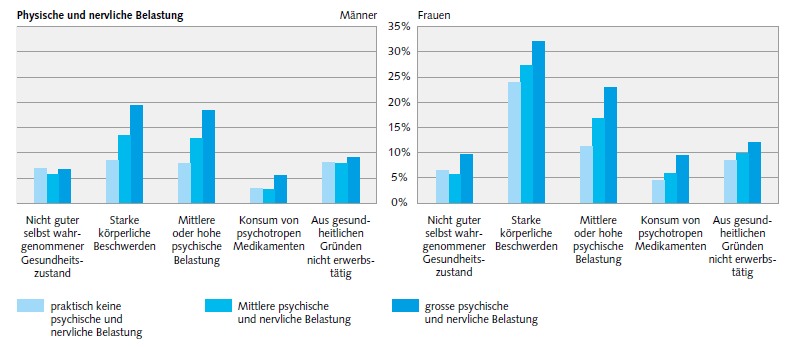
Wenn andere sich so verhalten, dass
Vertrauen verdeckt, zugeschüttet wird, bleibt dann der Beeinträchtigte allein
ohne Vertrauen? Das bedeutet, nach Vollständigkeit und Quelle von Vertrauen fragen.
Der Zusammenhang von Vertrauen und Hoffnung besteht darin, dass Vertrauen nicht allein in die Vergangenheit gerichtet sein kann. Wer sein Vertrauen auf die Vergangenheit stützt lebt kausal und nicht final. Kausal: was gut war könnte aus Kontinuitätsgründen auch weiter gut bleiben, wo bleiben Möglichkeiten? Eine solche Grundlage bleibt kontingent. Das Vertrauen in die Zukunft ohne zwanghaftes Verbleiben in der Gegenwart kann final begründet sein, auch wenn im Gegenwärtigen und Vergangenen Negatives überwiegend war.
Vertrauen ist fundamentaler als Können, als Erfahrungswissen, als Wissen. Wie soll ein Mensch ohne Vertrauen als Grundfaktor des Glauben-Könnens sein Glauben-Können reifen lassen können?
Vertrauen wächst in Verbindung mit eigenen Tugenden. Es gehört also Arbeit an seiner eigenen Reifung dazu. Es geht nicht immer nur um Leistung, besser als andere zu sein, mehr zu haben - es geht um Welt als DU.
Hoffnung muss auf Wirkliches aufgebaut sein, wäre das nicht der Fall, dann wäre Vertrauen Irrtum. Dadurch sind Werthaltung und Erkenntniswissen (besonders auch eigene Erfahrung) eng verbunden.
Wir sollten verstärkt darüber nachdenken, wie die Bedienungsgesellschaft auch die Subsidiarität im Staat schwächt - und aus diesem Nachdenken heraus handeln: Heute in gemeinsame Zukunft.
Nicht nur somatisch gesund sein,
sondern vertrauensvoll leben - und wenn Aerzte nicht danach fragen, dann kann
sich jeder mindestens gut vorbereiten.
Sprechen mit Aerzten eine Sendung von Radio SRF 2 DRS
hier
http://www.srf.ch/sendungen/kontext/wie-patienten-und-aerzte-miteinander-sprechen
links werden nicht dauerhaft behalten: Wenn's nicht mehr geht, dann versuchen Sie es hier
http://www.srf.ch/sendungen/puls/gesundheitswesen/aerzte-hoeren-oft-nicht-zu
Schliesslich doch noch eine der seltenen Statistiken - hier somatoforme Beschwerden
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland,
ICD10: F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme
Störungen
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten, Links auf andere Fundstellen.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||